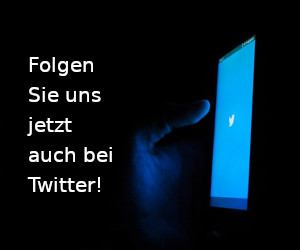Flächenländer wie Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen vereint der Wunsch nach einer flächendeckenden und qualitativ hochwertigen medizinischen Versorgung. Welchen Beitrag können Digitalisierung und Telemedizin für Versorgungssicherheit und -gerechtigkeit leisten? Das diskutierten Vertreter:innen der Länder Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen unter der Moderation von Prof. Dr. Neeltje van den Berg (Universitätsmedizin Greifswald) und Dr. Franz Bartmann (Vorstandsmitglied der DGTelemed).
Mecklenburg-Vorpommern
Dem Mangel an neurologischen Fachpraxen und der daraus resultierenden Terminvergabeproblematik begegnet man mit dem Innovationsfondsprojekt „NetKoH – Neurologisches Konsil mit Hausärzten“. Um die neurologischen Praxen zu entlasten, steht zu den üblichen Zeiten ein Tele-Neurologe in der Klinik zur Verfügung. Prof. Dr. med. Felix von Podewils, Geschäftsführender Oberarzt an der Klinik und Poliklinik für Neurologie der Universitätsmedizin Greifswald, beschreibt: „Hausärztinnen und -ärzte können in on-time Konsilen gemeinsam eine Triagierung vornehmen: Kann in der Hauarztpraxis behandelt werden? Ist die Überweisung in eine neurologische Praxis erforderlich oder eine dringliche Einweisung in die nächstgelegene Klinik?“ Erste Ergebnisse lassen vermuten, dass es zu einer deutlichen Optimierung der Patientenflüsse kommt. Weniger Patient:innen werden zum Neurologen überwiesen. Einweisungen ins Krankenhaus finden passgenauer und strukturierter statt.Einen Einblick in die Neuropädiatrie gab Sarah Heimbuch, Institut für Community Medicine der Universitätsmedizin Greifswald. Demografische und strukturelle Gegebenheiten in Mecklenburg-Vorpommern führen dazu, dass pädiatrische Abteilungen in Kliniken kaum wirtschaftlich und hoch-qualitativ betrieben werden können. Noch extremer wird die Situation, wenn spezialfachärztliche Versorgung erforderlich ist. Das Resultat sind lange Anfahrtswege und Wartezeiten auf Termine. Im Innovationsfondsprojekt RTP-Net (Regionales Telepädiatrisches Netzwerk) wurden telemedizinische spezialfachärztliche Konsultationen inkl. Datenübermittlung durchgeführt, um zu prüfen, ob diese den Anteil an wohnortnaher Versorgung erhöhen können. Die Evaluation zeigt, dass 76% der Patient:innen mit Unterstützung von Telekonsilen weiter vor Ort behandelt werden konnten. In der Kontrollgruppe waren dies nur 41%.
Niedersachsen
Die Initiative Gesundes Ostfriesland e. V., die regionale Projekte bündelt und koordiniert, stellte Dr. Phillip Walther, stellv. Vorstandsvorsitzender des Vereins, vor. Aus über 100 Akteuren entstand ein digitales, regionales Versorgungsnetzwerk. Drei Arbeitsgruppen spiegeln wider, welche Themen der Verein adressiert: 1) Fachkräfte Gesundheit, Pflege und Soziales, 2) Gesundheitsversorgung und Digitalisierung und 3) Gesundheitsförderung und Soziales. Digital-Projekte im Verein sind z. B. Telekonsile zwischen Pflegeheime und Hausärzt:innen (inkl. TI-Messenger) sowie Telemonitoring von Herzpatient:innen gemeinsam mit Dr. med. Eimo Martens vom Telemedicine Center der TU München (DGTelemed-Vorstandsmitglied). Ganz besonders freut sich Herr Dr. Walther über eine dreijährige Förderung durch den Landkreis Aurich für eine telemedizinisch unterstützte Community Health Nurse.
Schleswig-Holstein
Mit dem Innovationsfondsprojekt „KULT-SH – Kinderonkologische Untersuchung durch Leistungsfähige Telemedizin in Schleswig-Holstein“ stellten sich die Gewinner des Telemedizinpreises 2024 vor (Prof. Dr. Dr. Fabian-Simon Frielitz, Leiter Telemedizin, Digitalisierung und Ökonomie in der Medizin an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, und Prof. Dr. Denis Schewe, Leiter der Klinik für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden). In Schleswig-Holstein sind lange Anfahrtswege zu spezialisierten Kliniken üblich. Das ist insbesondere für Kinder in der Intensivphase einer Krebstherapie und deren Familien sehr herausfordernd. 36% der 48 Studienteilnehmer:innen hatten einen durchschnittlichen einfachen Anfahrtsweg von 86km. Die Evaluation zeigt, dass durch den Einbezug der KULT-SH-App über 42.000 km Strecke eingespart werden konnten. Darüber wurden u. a. Videosprechstunden abgehalten oder Vitalparameter über externe Sensoren erfasst. Frielitz und Schewe ergänzten, dass der Telemedizinpreis eine starke Außenwirkung gehabt habe und die Beantragung weiterer Fördermittel für wichtige Projekte erleichtern könne.Telemedizin im praktischen Alltag demonstrierte Frederik C. Denis, Geschäftsführer der HowRyou GmbH. Die Pflegeassistenzplattform “NEDINA®” gibt pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen Sicherheit, nimmt Einsamkeit und schafft Zufriedenheit. Pflegebedürftige haben die Möglichkeit in ihrer Häuslichkeit zu bleiben, da mittels Sensorik und KI relevante Informationen gesammelt und in auffälligen Situationen entsprechende Personen benachrichtigt werden. Zudem bleiben die Betroffenen über Videokommunikation sozial integriert. Dies führt zu Arbeitsentlastung, Qualitätssteigerung und mehr Lebenszufriedenheit. “NEDINA®” ist sowohl für den privaten als auch für den professionellen Einsatz in der Pflege geeignet.
Dr. med. Hendrik Schönbohm, hausärztlicher Vorstandsvorsitzender der Medizinischen Qualitätsgemeinschaft Rendsburg (MQR) eG, und Uta Clausen, pneumologische Assistentin, stellten das Versorgungsprojekt “TeLAV – Telemedizinische Lungenfunktions-App mit Vernetzung” (Förderung aus dem Versorgungssicherungsfonds) vor. TeLAV verfolgt das Ziel, Patient*innen mit einer Lungenfunktionseinschränkung wie COPD durch innovatives telemedizinisches Monitoring im häuslichen Umfeld zu versorgen. Die Patient:innen berichten von einer besseren Selbstwirksamkeit, mehr Kontrolle und einem damit verbundenen Mehr an Sicherheit. Die Evaluation des Projektes zeigte, dass die digitale Spirometrie gut angenommen wurde und Patient:innen (medikamentös) stabiler eingestellt wurden, wodurch Krankenhausaufenthalte vermieden werden konnten.
Diskussion
Anschließend diskutierten Vertreter der Länder unter der Moderation von Rainer Beckers (DGTelemed-Vorstand und Geschäftsführer der ZTG GmbH) über die Zukunft der Versorgung. Die Diskutanten, darunter Christian Nestler, Leiter des Referats Zukunftsorientierte Gesundheitsversorgung im Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport Mecklenburg-Vorpommern, und Dominik Völk, Leiter der Abteilung Gesundheitsversorgung im Ministerium für Justiz und Gesundheit des Landes Schleswig-Holstein, betonten Bedeutung und Notwendigkeit digitaler Lösungen in der sektorenübergreifenden Zusammenarbeit. Angesichts des demographischen Wandels wird die Sicherstellung der Versorgung in ländlichen Regionen zu einer immer wichtigeren Herausforderung.Ein weiteres zentrales Thema war die Finanzierung von Projekten. Viele Initiativen liefen Gefahr auszulaufen, wenn keine Lösungen zur Übergangsfinanzierung entwickelt würden. So wurde z. B. der Versorgungssicherungsfonds, der ursprünglich als Anschubfinanzierung für sektorenübergreifende Gesundheitsprojekte in Schleswig-Holstein eingeführt wurde, aufgrund der angespannten Haushaltslage in diesem Jahr ausgesetzt. Neue Projekte können somit nicht mehr gestartet werden.
Ebenfalls diskutiert wurde die Notwendigkeit regionaler Lösungen und das Fehlen geeigneter Managementstrukturen, die für die Koordination und Steuerung digitaler Gesundheitsprojekte erforderlich sind. Der Aufbau von Netzwerken nach dem Beispiel „Gesundes Ostfriesland e. V.“ könnte eine Lösung sein, um regionale Gesundheitsinitiativen zu fördern und langfristig zu sichern.
Rainer Beckers schließt: „Es gilt, mit allen beteiligten Akteuren ins Gespräch zu gehen und die Zusammenarbeit zwischen Versorgung, Selbstverwaltung, Politik, Forschung und Wirtschaft zu stärken. Ein stabiler politischer Rahmen ermöglicht es innovativen Projekten, nachhaltige Lösungen zu etablieren, die im besten Fall dauerhaft in die Regelversorgung überführt werden können, um die gesundheitliche Versorgung, insbesondere in ländlichen Regionen, zu stützen.“
Über die Deutsche Gesellschaft für Telemedizin
Die DGTelemed e. V. versteht sich als Forum für Kommunikation, Diskussion und Interessenvertretung in der Telemedizin in Deutschland und Europa.Patientenorientierung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Leistungserbringern, Gesundheitsdienstleistungs- und Medizintechnikunternehmen, Verbänden und Vereinigungen gehören zum Grundverständnis ihres Handelns.